Dem Ende
zugeneigt
MELANCHOLIE DES WIDERSTANDS an der Staatsoper Unter den Linden
|
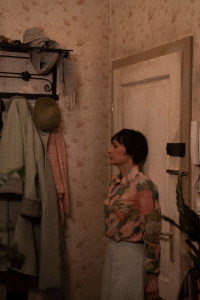
Sandrine Piau (als Rosi Pflaum) in Melancholie des Widerstands mit der Musik von Marc-André Dalbavie - an der Staatsoper Unter den Linden | Foto (C) William Minke
|
Bewertung der "filmischen Oper": 
Unsere Zivilisation (oder vielmehr der Teil von ihr, der mehr oder weniger "westlich" geprägt ist) hat derzeit eine besonders große Angst vor der für sie so völlig unvorhersehbaren Zukunft, denn sie steckt inmitten eines neuartigen Kampfes zwischen Demokratie und Autokratie; der Ukraine- wie der Gazakrieg bezeugen diesen neuen Weltkonflikt, und es bleibt spannend, wer zuletzt als welcher "Sieger" aus dem allen triumphieren wird: Putin, die Hamas?? Alles scheint offen, ja und mit dem volkstümlichen Die-Hoffnung-stirbt-zuletzt kann letztlich auch kaum wer noch etwas anfangen. Fakt ist, wir sog. Zivilisten stecken ungefragt da mittendrin, und keiner von uns weiß, wie klug oder wie dumm die Staatenlenker, denen wir uns demokratisch anvertrauten, sein werden, um Schlimmstes zu verhindern.
All das gab und gibt den kreativen Pessimistinnen und Pessimisten unsrer Zivilisation einen gestalterischen Raum, sich an Weltuntergangsszenarien zünftigst auszutoben - ob in Dystopieentwürfen oder andern Endzeitvarianten; das war in den Zeiten vor und nach dem Ersten/ Zweiten Weltkrieg übrigens nicht unähnlich.
Ganz aktuell: Peter Eötvös' Oper über den Valuschka oder Alex Garlands Bürgerkriegsfilm Civil War - diese zwei Beispiele zählen mitunter zu den jüngsten ihrer Art.
Topaktuell: Melancholie des Widerstands (ebenso, wie beim o.g. Eötvös, frei nach dem gleichnamigen Roman von László Krasznahorkai) an der Staatsoper Unter den Linden.
"In einer kleinen Stadt, irgendwo in Europa, irgendwo an der Peripherie. Die Zeit scheint stehengeblieben zu sein, der Alltag ist unberechenbar geworden, die Zukunft lässt wenig hoffen. Es ist eine Welt, die den Anschein hat, kurz vor der Apokalypse zu stehen. Dunkle Schatten einer nicht recht greifbaren Bedrohung haben sich über den Ort und seine Bewohner gelegt. Einige von ihnen aber suchen die Wirklichkeit hinter sich zu lassen: ein Musikprofessor mit seinem Sinn für reine, unverfälschte Tonstimmung, ein sonderbarer junger Mann mit seinem Interesse für die Weite und den Zauber des Kosmos, Frauen zwischen Angstzuständen und Machtinstinkt. Und dann sorgt die Ankunft einer mysteriösen Schaustellertruppe mit skurrilen Gestalten und seltsamen Attraktionen für neue Verwerfungen..." (Quelle: staatsoper-berlin.de)
Ging/ geht als Oper (konkreter: "filmische Oper") durch, weil es - außer viel, viel filmischem und szenischem Beiwerk (Director of Photography: Chris Kondek; Konzept und Inszenierung: David Marton) - auch Musik von Marc-André Dalbavie zu hören gab; das Libretto steuerte der Lyriker Guillaume Métayer bei. Und zusammen mit der Dirigentin Marie Jacquot, die die Uraufführung musikalisch leitete, schien alles freilich mehr oder weniger in französischer Hand zu sein; auch wurde ausschließlich französisch gesungen und gesprochen.
Auf die Frage der projektbegleitenden Dramaturgin Franziska Baur [auf blog.staatsoper-berlin.de], weshalb die lt. der ungarischen Romanvorlage in Ungarn oder anderswo spielende Erzählung "in eine nordfranzösische bzw. belgische Realität verlagert" wurde, antwortete der Regisseur wie folgt:
"Die Verlagerung hat die Sprache der Komposition vorgegeben. Die Muttersprache des Werks ist die Französische. Weil wir filmisch arbeiten, war uns schnell klar, dass wir ein anderes Verhältnis zu Sprache suchen, als bei einer reinen Bühnenaufführung. Traditionell haben die Muttersprachen der Menschen, die auf der Bühne stehen, oft wenig mit der Sprache des Werkes und der Sprache des Landes zu tun, wo das Werk aufgeführt wird. Das sagt viel darüber aus, welche Rolle Sprache im klassischen Sinne in der Oper einnimmt – oft ist sie eine Barriere. Für unsere Arbeit war es zentral, an Feinheiten zu arbeiten. Da ist es unmöglich, sprachliche Barrieren heimlich zu übertünchen und zu behaupten, man spräche zum Beispiel in Ungarn Französisch. Eigentlich war es ganz einfach: Marc-Andrés Vokallinien brauchten die französische Sprache und für mich musste die Inszenierung an einem Ort stattfinden, wo Französisch gesprochen wird." (David Marton)
Erklärbedarfe ohne Ende.
Und was gab es nun während der 135 pausenlosen Spielminuten alles so zu sehen und zu hören?
|

Philippe Jaroussky (als Valouchka) in Melancholie des Widerstands mit der Musik von Marc-André Dalbavie - an der Staatsoper Unter den Linden | Foto (C) William Minke
|
*
Insbesondere Philippe Jaroussky, der französische Countertenor-Weltstar! Er war als Briefträger Valouchka besetzt, der einem irgendwie so vorkam wie als fiele er von einem andern Stern auf unsere so arg geschund'ne Mutter Erde - und apropos Mutter: Sandrine Piau (ebenso wie Jaroussky aus der Alten Musik kommend) verkörperte Rosi Pflaum, die ihren Sohn Valouchka einst gebar und jetzt inmitten dieser merkwürdigen Weltenaufgelöstheit, vorerst noch geschützt in ihren eigenen vier Wänden, stak. Am Schluss der Dystopie wird sie von einem umhermarodierenden Männer-Mob erschlagen worden sein, ihr blutüberströmter Leichnam ist als Groß-Standbild im Hintergrund zu sehen.
Das Gegenpaar der "Filmoper" wird von Matthias Klink (als Komponist Georges Esther) und Tanja Ariane Baumgartner (als dessen verhasste Gattin Angèle Esther) bestimmt. Die beiden haben nur insofern miteinander zu tun, dass sie ihm ab und zu die Wäsche wäscht, um quasi notdürftig Kontakt zu ihm zu halten, denn sein spiritueller Einfluss auf die Gemeinde, die sie kraft ihrer frauenbündlerischen Eigeninitiative "Gekehrtes Heim, Ordnung muss sein" (?!) zu verändern/ verbessern gedenkt, scheint immer noch beträchtlich zu sein. Er seinerseits klimpert von früh bis spät auf seinem verstimmten Steinway herum, um nach irgend einem Idealton zu suchen - wahrscheinlich findet er ihn auch zum Ende hin; die Klimperszene ist dann auch der szenische Rahmen dieses wirren Stücks.
Es zieht und zieht sich hin...
Bis kurz nach Eintreffen des mysteriösen Zirkus mit dem Riesenwal als Attraktion Bewegung in die Handlung kommt, um sich schlussendlich in Gewaltorgiastik zu entladen: Der oben bereits erwähnte Männer-Mob zieht mit Baseballschlägern durch die Stadt und schlägt ganz wahllos alles kurz und klein; und wer sich ihm groß in den Weg stellt, muss dann halt dran glauben (siehe Rosi Pflaum) - irrigerweise wird der Schlägertrupp vom Gutmenschen Valouchka eine Zeitlang "angeführt" - der hoffte noch, dass sich seine gewalttätige Stimmung dank seines Gutmenscheneinflusses ausbremsen ließe oder so.
Und zwischendrin dann viel, viel Sprechgesang, aber auch ariose und mitunter angenehm-schön anzuhörende Einzelauftritte einiger singender Protagonisten.
Die Alleskönnerinnen und Alleskönner der Staatskapelle Berlin brillierten mit ihren instrumentalen Einsätzen - nichts anderes hätte man von ihnen erwarten wollen!
Enormer Kraftaufwand, gigantische Logistik!!
Aber wozu das Ganze?
* *
Die genremäßige Betonung auf "filmische Oper" wohl deshalb, weil das meiste des Gezeigten großleinwandmäßig, also im ziemlich nahen Hintergrund, erfolgte. Zudem ist auf der meistens (von der Großleinwand) verdeckten Drehbühne eine Szenenlandschaft von Amber Vandenhoeck gebaut worden, in der mit Live-Kameras Einzelszenen gefilmt und simultan auf der Großleinwand gezeigt werden; alles im Stile von Frank Castorf, und von wegen Alleinstellungsmerkmal.
Summa summarum:
Entnervend und entmutigend (das Letztere vor allem).
|
Andre Sokolowski - 9. Juli 2024
ID 14830
MELANCHOLIE DES WIDERSTANDS (Staatsoper Unter den Linden, 07.07.2024)
Mélancolie de la résistance
Eine filmische Oper
Musik von Marc-André Dalbavie
Musikalische Leitung: Marie Jacquot
Konzept und Inszenierung: David Marton
Bühne: Amber Vandenhoeck
Kostüme: Pola Kardum
Director of Photography: Chris Kondek
Kamera: Chantal Bergemann und Adrien Lamande
Licht: Miriam Damm
Sounddesign: Torsten Ottersberg
Dramaturgie: Franziska Baur und Detlef Giese
Besetzung:
Georges Esther ... Matthias Klink
Angèle Esther ... Tanja Ariane Baumgartner
Rosi Pflaum ... Sandrine Piau
Valouchka ... Philippe Jaroussky
Notable Hagelmayer, Aubergiste ... Roman Trekel
Notable Nadaban ... Christian Oldenburg
Notable Madai ... David Oštrek
Le chef de la police ... Sébastien Dutrieux
La femme du centre de tri ... Anna Kissjudit
Le directeur du cirque ... Jan Martiník
L'homme à tout faire du cirque ... Julian Mehne
Un Poivrot ... Rory Green
Policier 1 ... Viktor Rud
Un Médecin ... Ulf Dirk Mädler
Soldat 1 ... Taehan Kim
Soldat 2 ... Adam Kutny
Soldat 3 ... Florian Hoffmann
Staatskapelle Berlin
UA war am 30. Juni 2024.
Weitere Termine: 10., 12.07.2024
Auftragswerk der Staatsoper Unter den Linden
Weitere Infos siehe auch: https://www.staatsoper-berlin.de
https://www.andre-sokolowski.de
Konzerte
Musiktheater
Neue Musik
Rosinenpicken
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeigen:

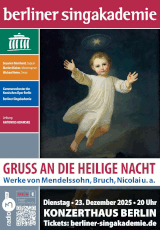

Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CD / DVD
KONZERTKRITIKEN
LEUTE
MUSIKFEST BERLIN
NEUE MUSIK
PREMIERENKRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
RUHRTRIENNALE

= nicht zu toppen

= schon gut

= geht so

= na ja

= katastrophal
|